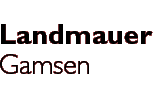Programm
Samstag, 13. September 2025
17.00 Uhr
Vernissage der Jubiläumsschrift «30 Jahre Stiftung Landmauer Gamsen» In der Alten Suste in Gamsen.
Die Vernissage wird umrahmt von:
– einem Musikensemble
– einer Lesung von Nicolas Eyer
– einem Apéro
Sonntag, 14. September 2025
ab 09.00 Uhr
Tag der offenen Tür
11.00 Uhr
Offizieller Akt und Jubiläumsfeier
Tambouren und Pfeifer
Festwirtschaft
17.00 Uhr
Offizielles Ende des Tages der offenen Tür
Gründung der Stiftung und Sanierung der Landmauer
Die erste Erwähnung der Gamsner Landmauer stammt aus dem Jahre 1389: «a fortalicia seu barreria de Gamsen superius» (Archiv des Domkapitels Sitten, Minutar A 43, Seite 99)
Nach Walter Ruppen wurde die 1392 als «letzin» urkundlich erwähnte Talsperre in den Jahren 1352-1355 in der Auseinandersetzung mit dem Herzog Amadeus Vl. und dem Savoyen freundlichen Bischof Witschard Tavelli von den Gemeinden der oberen Zenden Naters, Mörel und Goms unter Einbezug eines älteren Dammes der Gamsa als Gemeinwerk errichtet. Ursprünglich sperrte die Mauer mit einer Gesamtlänge von etwa 850 m die Talenge von Gamsen zwischen Rotten und dem Eingang des Nanztales. Heute ist sie in unterschiedlichen Teilen noch zur Hälfte mehrheitlich sichtbar. Die gegen 6 Meter hohe und 1.70 – 2.10 Meter breite Mauer besteht aus einem harten Kalkmörtel-Füllmauerwerk zwischen Mauern aus verschiedenen Quadern und Kieseln. Sie war mit Zinnen, Wehrgang und Basteien versehen und diente ohne Zweifel zur Verteidigung gegen einen Angriff von Westen. Nach dem Kantonsarchäologen Louis Blondel kann die Gamsamauer mit den gleichzeitig entstandenen Letzinen oder Landmüren der Urschweiz verglichen werden.


Aus dem Lehrfilm der BEPW Productions in Zusammenarbeit mit der Stiftung Landmauer und Dr. Hans Steffen, Historiker, und Paul Heldner, Stiftungsrat
Bereits 1958 verfasste Louis Blondel den leidenschaftlichen Aufruf, «dieses Werk von nationaler Bedeutung vor dem drohenden Verfall zu retten, diente die Mauer doch bis in unsere Tage als Steinbruch.» (WB, 16.3.95, S. 13) Auch der Wunsch unseres Lokalhistorikers Paul Heldner für den Erhalt und die Restaurierung dieses Baudenkmals blieb lange Zeit ungehört.
In einem Gutachten schrieb Prof. Dr. Werner Meyer 1981 (damaliger Präsident des Schweizerischen Burgenvereins): «Die Gamsamauer auf Gebiet der Stadtgemeinde Brig-Glis ist die einzige Wehranlage ihrer Art, von der noch bedeutende, über eine längere Distanz zusammenhängende Bauteile aufrecht stehen. Als Dokument der kampfgeladenen Walliser Geschichte im Spätmittelalter und als einziges Beispiel einer Letzi mit ansehnlicher Mauersubstanz im ganzen schweizerischen Alpenraum ist die Mauer trotz ihrer Unscheinbarkeit als Monument von grossem historischem Wert einzuschätzen.» (WB, 18.10.2006)


Nach Dr. Hans Steffen spielten nicht nur politisch-militärische Überlegungen für den Bau der Mauer eine grosse Rolle, sondern auch wirtschaftliche Überlegungen. «Obwohl die aktuelle Mauer eindeutig eine Verteidigungsmauer war (mit Zinnen, Wehrgängen etc.) hatte die Mauer zu allen Zeiten noch andere Funktonen: Sie war ein geeigneter Ort, um Zölle zu erheben, sie war eine effiziente Barriere gegen die Ausbreitung von Seuchen (vor allem der Pest), sie war ein optimaler Schultz gegen Viehdiebstahl und Überfälle und sie schützte vor Überflutungen der Gamsa. All diese Funktionen sind durch Quellen belegt, so dass es falsch wäre, nur den militärischen Aspekt zu berücksichtigen.» Hans Steffen: Die Mauer von Gamsen. Sonderdruck aus: Blätter aus der Walliser Geschichte XLII. Band 2021
Die «Pro Historia Glis» unter Präsident Heli N. Wyder übernahm die Schirmherrschaft der Sanierung der Landmauer. Am 15. Mai 1995 wurde die Stiftungsurkunde unterzeichnet. Die «Stiftung Landmauer Gamsen» ist alleiniger und im Grundbuch eingetragener Besitzer der Mauer. Der erste Präsident des Stiftungsrates war Dr. Sigmund Widmer, Historiker und früherer Stadtpräsident von Zürich. Die Stiftung bezweckt die Rettung, Erhaltung und Klassierung der Landmauer als nationales Baudenkmal. Auch soll die Landmauer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zudem will die Stiftung die historische Forschung bezüglich der Landmauer und der damit in Zusammenhang stehenden historischen Fragen fördern.

So sah Zeichnungslehrer Wilhelm Ritz (Bruder des bekannten Malers Raphael Ritz) die Landmauer. Die Zeichnung wurde 1856 im «Anzeiger für Schweizerische Geschichte und Altertumskunde» veröffentlicht.
Das Verdienst des ersten Stiftungsratspräsidenten Sigmund Widmer bestand darin, Historiker und Politiker der kantonalen und eidgenössischen Instanzen von der nationalen Bedeutung und damit von der Schutzwürdigkeit des Bauwerkes zu überzeugen. Sodann sorgte er dafür, dass aus verschiedenen Quellen Gönnerbeiträge flossen. Die Leistung von Sigmund Widmer kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seinem Verhandlungsgeschick, seinem Willen und seiner Durchschlagskraft ist es zu verdanken, dass dieser Zeuge einer entschwundenen Epoche der Nachwelt erhalten bleibt.
Nachdem die Eigentumsverhältnisse mühsam abgeklärt wurden, konnte mit der Konservierung und Restaurierung des historischen Bauwerks begonnen werden. Auf eine eigentliche Rekonstruktion verzichtete man bewusst. Die ursprünglichen Dimensionen des Bauwerkes mit Zinnen und Wehrtürmen lassen sich dank den nun gesicherten Mauerresten erahnen. Rund 2 Millionen kostete bisher die Sanierung der Landmauer und der Suste.


Die Landmauer wird für die Besucher über einen Kultur- und Naturweg erschlossen. Hinweistafeln verweisen auf die historische Bedeutung und erläutern bautechnische Besonderheiten.
Zukunftspläne
Der Abschnitt Nord, der von der Strasse aus gut zu sehen ist, muss dringend saniert werden und soll sich in Zukunft als Aushängeschild der Landmauer präsentieren. Deshalb sind alle gefordert, sich für eine maximale Lösung einzusetzen. Die Stiftung schlägt vor, dass die geplante Gestaltung folgende Kriterien erfüllt:
- Werbeträger für die Landmauer: man sieht von der Kantonsstrasse aus, wo sich die Mauer befindet.
- Werbeträger für die Stadtgemeinde: Die Stadtgemeinde erhält eine schöne und geschichtsträchtige Einfahrt.
- Die Landmauer kann als Stadtmauer der Agglomeration von Brig und Glis angesehen werden.
- Werbung für den Natur- und Kulturweg und für den Dorfrundgang Gamsen
- Das Gelände rund um die Mauer kann als Kinderspielwiese ausgebaut werden.
Eckdaten
- Mai 1995: Stiftung «Landmauer Gamsen», das Präsidium übernahm Dr. Sigmund Widmer
- März 2003: Heli N. Wyder wird Präsident der Stiftung
- Oktober 1995: Unterschutzstellung des Kantons
- Mai 1999: Einstufung der Landmauer Gamsen als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung durch das Bundesamt für Kultur
- 10.2005: Einweihungsfeier Natur & Kulturweg Gamsen
- April 2006: Schaffung einer Freihaltezone entlang der Landmauer
- September 2012: Einweihung der Suste
- Januar 2023: Gründung des Vereins «Freunde der Landmauer»
Heli N. Wyder und Marianne Mathier